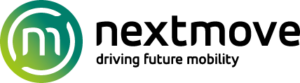Im letzten Jahr wurde von etlichen Medien getitelt, es gäbe ein Überangebot an Ladesäulen. Laut BDEW stand eine Gesamtleistung von 4,5 Gigawatt zur Verfügung. Die durchschnittliche Belegung der Ladesäulen betrug nie über 20 Prozent. Daher kamen sie zu dem Schluss, dass der aktuelle Ladesäulenbestand sogar den tatsächlichen Bedarf überschreite. Wie hoch der Ladebedarf in den kommenden Jahren sein wird, hat auch die Studie „Ladeinfrastruktur nach 2025/2030: Szenarien für den Markthochlauf“ untersucht. Die Studie wurde vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr in Auftrag gegeben und wurde erstmalig 2020 veröffentlicht. Durch neue Daten und Erkenntnisse wurde sie 2024 neu aufgelegt. Die Studie geht davon aus, dass die benötigte Ladeinfrastruktur für die steigende Anzahl der E-Autos bereits im Vorfeld entstehen muss. Das bietet auch potenziellen Käufern mehr Sicherheit bei der Frage, ob es genügend Ladesäulen gibt. Das bedeutet auch, dass es im Optimalfall ein Überangebot geben muss. Laut BDEW ist das gemessen an der Gesamtleistung der Fall. Regional gibt es noch immer Lücken bei den Ladepunkten, es bedarf aber einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur.

In der Studie wird davon ausgegangen, dass es 2030 13,4 Millionen BEVs und 3,2 Millionen PHEVs gibt. In die Berechnungen gehen sowohl öffentliche als auch nicht-öffentliche Ladepunkte ein. Zu den nicht-öffentlichen zählen Eigenheime, Mehrparteienhäuser und Unternehmen. Zu den öffentlichen gehören Kundenparkplätze, Straßenraum, Lade-Hubs und Lade-Hub-Achsen. Insgesamt wurden fünf Szenarien unterschieden. Als Referenzszenario gilt eine moderate Verfügbarkeit von nicht-öffentlichen Ladepunkten und kein besonderer Fokus auf HPC-Ladeinfrastruktur bis 2030. In einem anderen Szenario geht man von einer geringen Verfügbarkeit von nicht-öffentlicher Ladeinfrastruktur aus. Das bedeutet zehn Prozent weniger Ladeinfrastruktur zuhause und sechs Prozent weniger Ladeinfrastruktur im Unternehmen gegenüber dem Referenzszenario. Ein weiteres Szenario geht von einer hohen Anzahl nicht-öffentlicher Ladepunkte aus. Hier sind es zehn Prozent mehr zuhause und sechs Prozent mehr im Unternehmen verglichen mit dem Referenzszenario. Die Studie berücksichtigt außerdem ein Szenario der Digitalen Optimierung, welche sich auf die Standzeiten an Ladepunkten bezieht. Konkret sinkt die Abdeckung des 15-Minuten-Zeitfensters in 0,5-Prozent-Schritten von dem 99-Prozent-Quantil im Jahr 2025 auf das 96,5-Prozent-Quantil im Jahr 2030. Zuletzt wird auch ein HPC-Fokus berücksichtigt. In dem Szenario geht man davon aus, dass die Attraktivität am Lade-Hub um 50 Prozent steigt und die des Ladens im Straßenraum um 50 Prozent sinkt. Gleichzeitig erhöht sich die Anzahl der HPC-Ladepunkte auf Kundenparkplätzen um 30 Prozent.

Die Studie ermittelt einen Bedarf in absoluten Zahlen von 380.000 bis 680.000 öffentlichen Ladepunkten im Jahr 2030 – abhängig vom Szenario. Im Szenario mit wenig nicht-öffentlicher Ladeinfrastruktur ergibt sich der meiste Bedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur mit 681.000 Ladepunkten. Das sind 31 Prozent mehr verglichen mit dem Referenzszenario. Setzt man in Zukunft vermehrt auf HPC, benötigt man nur 384.000 öffentliche Ladepunkte. Verglichen mit dem Referenzszenario sind das 26 Prozent weniger Ladepunkte. Autor der Studie Johannes Pallasch über LinkedIn: „Das HPC-Szenario reduziert die Gesamtzahl an benötigten öffentlich zugänglichen Ladepunkten bei wachsender Anzahl von HPC-Ladepunkten, wobei die installierte Ladeleistung gegenüber dem Referenzszenario konstant bleibt“.

Neben den verschiedenen Szenarien haben auch Batteriekapazität und Stromverbrauch der E-Autos selbst einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse. Haben die E-Autos beispielsweise 20 Prozent weniger Batteriekapazität als aktuell, steigt der Bedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur um zwölf Prozent. Der Bedarf an HPC-Ladepunkten steigt sogar um 42 Prozent. Erhöht sich die Batteriekapazität allerdings um 20 Prozent, sinkt der Bedarf an öffentlichen Ladepunkten um neun Prozent, der Bedarf an HPC-Ladepunkten sogar um 26 Prozent. Ähnlich verhält es sich mit dem Stromverbrauch. Steigt der Stromverbrauch um 20 Prozent, steigt auch der Bedarf an öffentlichen Lademöglichkeiten um 16 Prozent. Sinkt er hingegen um 20 Prozent, sinkt der Bedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur um womöglich 15 Prozent und der Bedarf an HPC-Ladepunkten um 42 Prozent.

Im Referenzszenario haben 87 Prozent aller öffentlichen Ladepunkte eine Ladeleistung bis 50 kW und befinden sich am Straßenrand oder auf Kundenparkplätzen. HPC-Punkte machen zwar nur 13 Prozent aller Ladepunkte aus, sorgen aber für 61 Prozent der Gesamtladeleistung. Beim HPC-Fokus steigt der Anteil auf 24 Prozent, was 76 Prozent der Ladeleistung entspricht. Der Bedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur bis 50 kW ist somit bis zu 35 Prozent geringer. Abhängig von dem Szenario liegt die benötigte installierte Ladeleistung der Punkte zwischen 23,3 Gigawatt und 32,4 Gigawatt. Aktuell liegt die installierte Ladeleistung bei ungefähr 5,2 Gigawatt, Stand März 2024. Die aktuell installierte Leistung von Deutschen Erzeugungsanlagen liegt bei 330,8 Gigawatt. Demnach wird 2030 der Bedarf der installierten Ladeleistung 8,3 Prozent davon ausmachen. Das bedeutet es benötigt neben dem Ausbau an Ladeinfrastruktur auch einen Ausbau des Stromnetzes, und zwar an den Stellen, an denen es auch künftig Bedarf an Ladeinfrastruktur gibt. Vor allem also an HPC-Ladepunkten. Pro Ladepunkt werden voraussichtlich durchschnittlich 84 kWh pro Tag verladen. Die Studie geht davon aus, dass die in die Pkws verladene Menge insgesamt 37,8 TWh beträgt. Je nach Szenario wird die öffentliche Ladeinfrastruktur davon 36 Prozent bis 50 Prozent der Energie bereitstellen. Die E-Mobilität wird 2030 voraussichtlich sechs Prozent des Bruttostromverbrauchs ausmachen.

Die Studie geht sogar weiter als 2030 und nennt erste Prognosen für 2035. Man geht von 28 Millionen BEVs und PHEVs aus, wobei rein elektrische 90 Prozent davon ausmachen. Der Bedarf an öffentlichen Ladepunkten steigt je nach Szenario auf 580.000 bis 1,1 Millionen an. Im Referenzszenario steigt somit der Bedarf gegenüber 2030 um 59 Prozent an.
Was bedeuten die Ergebnisse der Studie konkret für die Zukunft? Laut der AFIR müssen die Staaten ab 2025 eine Ladeleistung von mindestens 1,3 kW für jeden BEV und für jeden PHEV 0,8 kW bereitstellen. Außerdem muss es alle 60 Kilometer eine Schnellladestation entlang der europäischen Hauptverkehrswege geben. „Der Bedarf an Ladeinfrastruktur liegt höher als die AFIR-Anforderungen. Die AFIR-Anforderungen sind der kleinste gemeinsame Nenner aller EU-Mitgliedsstaaten. (…) Eine politische Zahl, die nicht aus Nutzersicht ermittelt wurde“, so Johannes Pallasch. Bei den AFIR-Anforderungen handelt es sich demnach um Mindestziele. Laut Studie müsse vielmehr von 1,5 kW bis 2 kW Ladeleistung pro BEV und 0,8 kW bis 1,6 kW pro PHEV ausgegangen werden.